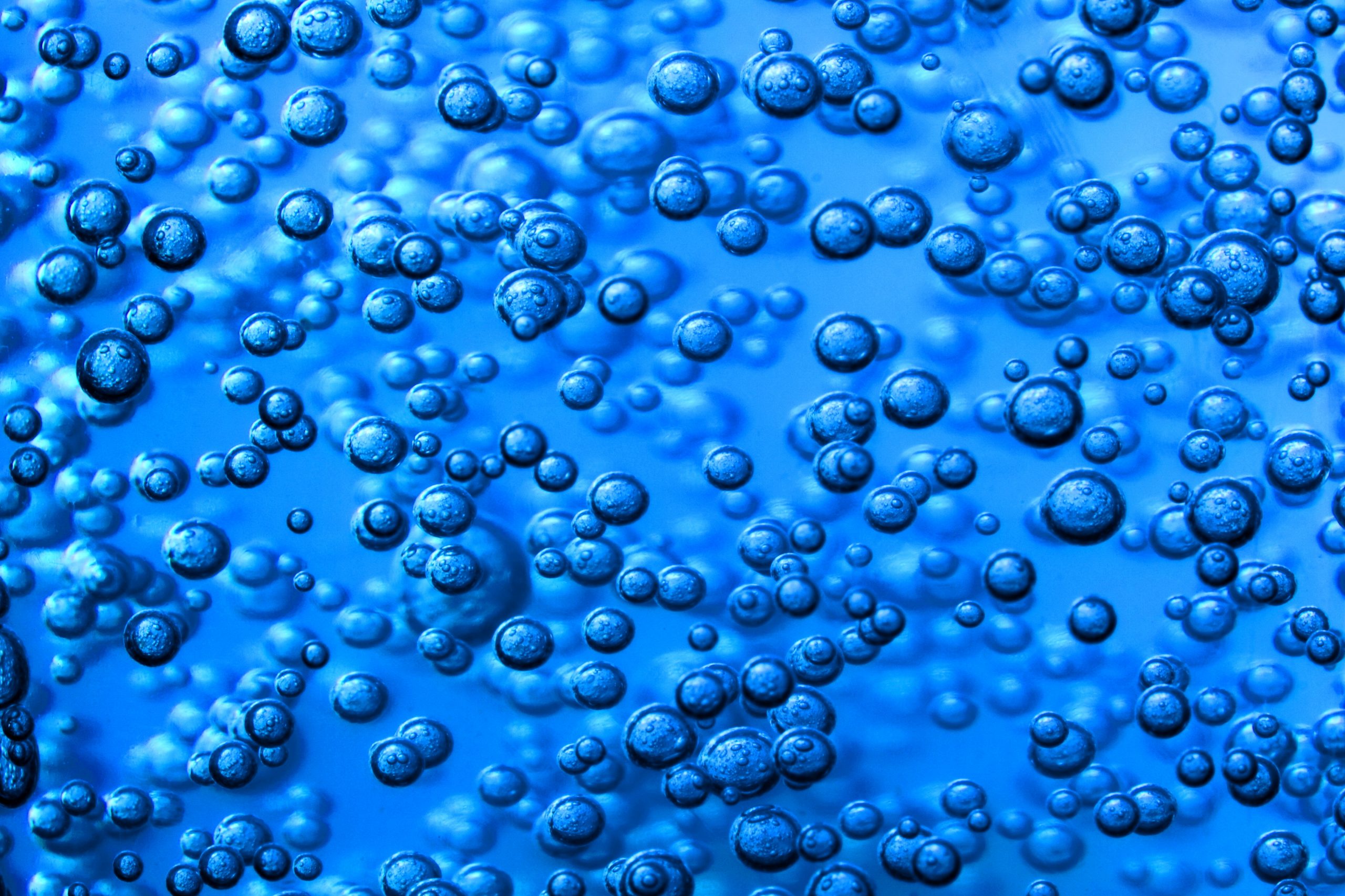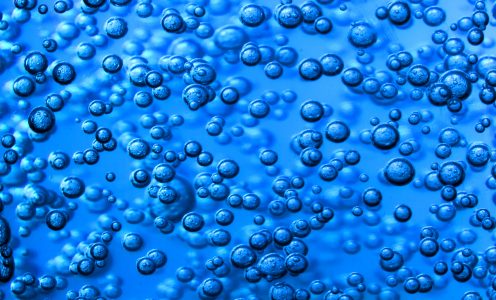In diesem Beitrag zeige ich, dass im Netzverknüpfungspunkt von Wind- und PV-Anlagen sowohl eine lokale Wasserstoff-Elektrolyse als auch eine Stromeinspeisung in das öffentliche Netz vorgenommen werden können. Mit ausreichend hoher Begrenzung der Elektrolyse- bzw. Netzkapazität („Überbauung“) können sowohl die Elektrolyse als auch die Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz mit hoher Auslastung betrieben werden. Das drückt sowohl die Kosten der Wasserstofferzeugung als auch die Kosten für das Stromnetz. Der Wasserstoff-Elektrolyse steht eine Stromnutzung ohne Nutzung des öffentlichen Netzes für z.B. industrielle Zwecke gleich.
Entgegen häufig geäußerter Vorschläge, „Überschussstrom“ für die Wasserstoff-Elektrolyse zu nutzen, statt ihn abzuregeln, führt dies zu einer Maximierung der Kosten der Wasserstoffproduktion aus dem einfachen Grund, dass die dann sehr geringe Auslastung der Elektrolyse zu sehr hohen Kapitalkosten führt, die dann die Wasserstoffkosten determinieren. „Überschussstrom“ wird hier definiert als solcher, für den der Börsenpreis negativ bis Null ist. Wenn man hingegen die Auslastung der Elektrolyse maximiert und diese auch bei hohen Börsenstrompreisen durchführt, führt dies auch zu relativ hohen Wasserstoffkosten. Das Kostenoptimum liegt bei rund 80 bis 100 % des jährlichen Strom-Durchschnittspreises.
Eine lokale Wasserstofferzeugung „kannibalisiert“ dabei nicht die Auslastung des Stromnetzes für den Teil der EE-Erzeugung, der nicht für die Elektrolyse verwendet wird. Eine vergleichsweise kostengünstige lokale Wasserstofferzeugung findet also nicht auf Kosten eines dadurch unwirtschaftlicher werdenden Netzbetriebs statt. Damit ist auch in küstenfernen Gebieten und ohne kurzfristig verfügbaren Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz eine attraktive Möglichkeit für lokale Wasserstofferzeugung gegeben.
Wie auch im Fall der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Quellen in einem Netzverknüpfungspunkt bei hoher Überbauung ohne Wasserstoffelektrolyse fallen auch bei einer lokalen Elektrolyse Abregelungsverluste an, die umso höher sind, je höher die Überbauung gewählt wird und je höher folglich die Auslastung der Elektrolyse bzw. die Netzauslastung sind. Diese müssen im Gesamtsystem finanziert werden. Die Kosten der Abregelung müssen geringer sein als z.B. die vermiedenen Kosten des Netzausbaus aufgrund einer besseren Netzauslastung. Auf die Möglichkeit, einen Teil der sonst abzuregelnden Erzeugungsmengen in Batteriespeichern aufzunehmen, sei hier ausdrücklich hingewiesen, dies ist aber nicht Gegenstand der hier vorgestellten Analyse.
Die Wasserstoffmengen, die mit dem hier vorgestellten Vorgehen kostengünstig im Binnenland erzeugt werden können, müssen in den Kontext des künftigen Bedarfs eingeordnet werden. In einem Erzeugungssystem mit beispielsweise 7,2 MW Wind und 3,6 MW PV an einem Netzverknüpfungspunkt können wirtschaftlich sinnvoll rund 100 bis 200 t Wasserstoff pro Jahr erzeugt werden (entsprechend mehr bei größeren Wind-/PV-Parks). Das ist vielfach für lokale industrielle Zwecke attraktiv, aber völlig unzureichend für den Kraftwerkseinsatz, um Dunkelflauten zu überbrücken. Dafür ist das geplante Wasserstoffnetz unabdingbar.